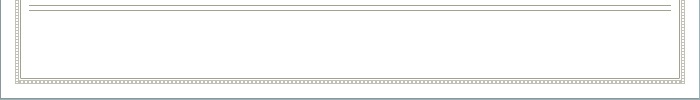Markus


Markus

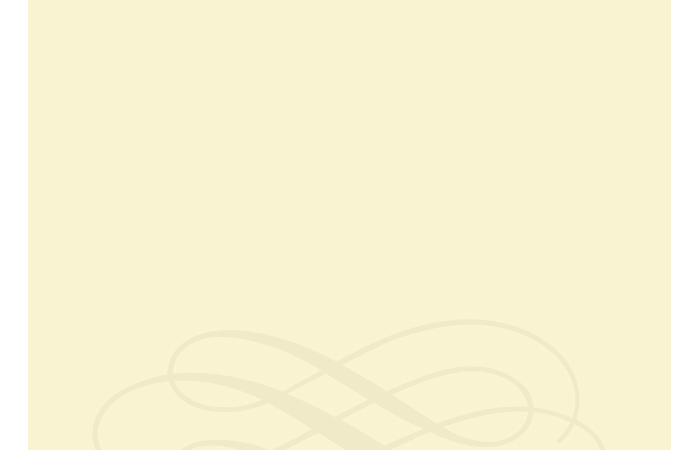
Markus
Markus ist das älteste und zugleich das kürzeste der vier kanonischen Evangelien. Es ist eine Zusammenstellung der Traditionen über Jesus in Form eines chronologischen Ereigniszusammenhangs vom ersten Auftreten in Galiläa bis zu den Osterereignissen in Jerusalem. Dazu wird ein lockerer chronologischer Rahmen entworfen. Markus hat im ersten Teil seines Evangeliums vor allem ältere mündliche Überlieferungen verarbeitet. Schriftlich lag ihm wohl die Passionsgeschichte und evtl. Mk 13 vor. Über den Verfasser des Evangeliums ist nichts weiteres bekannt. Es handelt sich wohl um einen Heidenchristen, der vor und rund um 70 n.Chr. außerhalb von Palästina wirkte. Sein Evangelium war vor allem in galiläischen Gemeinden bekannt (vgl. den sekundären Markusschluss in Mk 16,9-20).
Das Evangelium beginnt nicht mit der Geburt Jesu, sondern mit dem Auftreten Johannes des Täufers. In ihm erkannte die urchristliche Gemeinde den wiedergekehrten Elia (Elia redivivus), auf dessen Wiederkehr das Judentum seit seiner Entrückung (2Kön 2) wartete. Ihm wird nach Jes 40,3 und Mal 3,1 die Funktion des Wegbereiters in der Wüste zugesprochen. Damit verbürgt er in seiner Person zwei für das Urchristentum sehr wichtige Elemente: Zum einen zeigt seine Wiederkehr an, dass die erhoffte Endzeit und das Auftreten des Messias nun einsetzen wird (Zeit), und zum anderen, dass er in der Lage ist, den Messias zu erkennen, da er von Gott für diese Aufgabe vorgesehen wurde (Person). Dies entspricht zwei für die neutestamentliche Zeit entscheidenden Kriterien, nach denen Überlieferungen beurteilt werden: Das Urchristentum verstand sich selbst als jüdische Gruppe, die damit in Kontinuität zu den göttlichen Verheißungen der alttestamentlichen Zeit steht. Damit verbunden ist das zweite wichtige Element: Die Frage nach der Legitimität der Überlieferung. Es bedurfte eines ganz besonderen Zeugen, damit Jesus als der Messias erkannt werden konnte. Es war nicht die Frage, ob es einen Messias gab, sondern ganz allein, wer von denen, die behaupteten, der erwartete Messias zu sein, der richtige ist. In diesem Sinne ist auch die Taufe, die Johannes am Jordan vollzog, zu verstehen. Sie diente als prophetische Zeichenhandlung und wie Mk 1,9-13 die Taufe Jesu zeigt, wird sie zu dem Ereignis, bei dem Johannes den Messias erkennt. Die Stimme vom Himmel war für ihn nicht zu überhören (Mk 1,11).
Mit Mk 1,14 setzt die geographische Ordnung der Jesus-Überlieferung nach Markus ein. Jesus kam nach Galiläa und begann dort seine Wirksamkeit. Was im Evangelium folgt, steht unter der Überschrift von Mk 1,15: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.
Mit Mk 1,16 setzt der erste große Abschnitt des MkEv ein, der sich, folgt man der geographischen Unterteilung, bis Mk 9,50 erstreckt. In Mk 10,1, dem auf den Abschnitt folgenden Vers, wird berichtet: Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet nach Judäa und jenseits des Jordans. Damit verlässt Jesus Galiläa und wendet sich gen Süd-Osten, wo die dann folgenden Ereignisse spielen.
In Mk 1,16-1,45 werden die Grundlagen für die folgende Verkündigung gelegt und der gesamte Umfang der Tätigkeit Jesu wird bereits angedeutet: Er beruft sich Jünger (Mk 1,16-20), lehrt in der Synagoge in Kapernaum, der zur Zeit Jesu bedeutendsten Stadt Galiläas (Mk 1,21-39), und heilt einen Aussätzigen (Mk 1,40-45). Damit ist die gesamte Bandbreite der Wirksamkeit Jesu für Markus bereits beschrieben: Ausbildung von nachfolgenden Gemeinden (Jünger), Lehre in Vollmacht (vgl. Mk 1,22) und Heilung von Kranken bzw. Exorzismen von bösen Geistern. Diese drei Elemente prägen das MkEv bis zum Beginn der Passionserzählung. Besonders hervorgehoben wird im ersten Teil des Evangeliums die Lehrtätigkeit Jesu. Diese zeigt sich in 5 Konflikten mit jüdischen Gruppen seiner Zeit (Mk 2,1-3,6). In diesen Streitgesprächen geht es um folgende Themen: Sündernvergebung, Essen mit Zöllnern, Fastenfrage, Ährenraufen am Sabbath, Heilen am Sabbath. Abgeschlossen wird diese Sammlung von einem summarischen Bericht über das Wirken Jesu in Mk 3,7-12.
Im Anschluss an diese Gespräche werden die irdischen Bezüge Jesu dargestellt. Die Frage, die den Autor hier wohl leitete, ist die nach denjenigen, die die Autorität besitzen, Jesu Botschaft weiterzutragen. Dazu stehen zwei Gruppen zur Auswahl: Die Jünger (Mk 2,13-19) und die leiblichen Verwandten Jesu (Mk 2,20f.). Zwischen diesen beiden Gruppen entbrennt ein Konflikt, den Markus als eine Frage nach dem Geist beschreibt, den der einzelne Mensch besitzt: Alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben, auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen; wer aber den heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig (Mk 2,28f.). Durch diesen Ausspruch wird das Verhalten der Jünger und der leiblichen Familie Jesu aufgehellt: Während die Jünger den in Jesus wirkenden Geist erkennen, selber ebenfalls im Besitz des heiligen Geistes sind und damit lehren und heilen können (Mk 2,15), halten die Familienangehörigen Jesu ihn für nicht mehr zurechnungsfähig (Mk 2,21). Die Antwort Jesu auf die Anschuldigung seiner leiblischen Verwandten folgt stehenden Fußes: In Mk 2,31-35 benennt Jesus seine engste Bezugsgruppe und seine Nachfolger: Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der Wille Gottes, der sich im Geistbesitz ausdrückt, ist also das Kriterium, an dem sich die Nachfolger Jesu zu orientieren haben und das zugleich das Verwandtschaftsverhältnis begründet. Dieses bedeutet dann: Jesu leibliche Verwandte können seine Familie werden, aber nicht, weil sie gemeinsame Vorfahren haben, sondern weil sie, wie die Jünger auch, den Willen Gottes tun.
Nachdem Markus klärte, wie und wer als Nachfolger Christi wirkt, stellt sich ihm die Frage nach dem Inhalt der Botschaft Jesu: das Reich Gottes. In den in Mk 4,1-32 folgenden vier Gleichnissen geht es zunächst darum, wie das Reich Gottes kommen wird. Da die Gleichnisse nicht für alle Leser / Hörer so einfach zu verstehen waren, fügt der Evangelist Markus nach dem ersten Gleichnis in Mk 4,10-12 eine Verstehenshilfe ein, die in Mk 4,13-20 sofort auf das zuvor stehende Gleichnis angewendet wird. Ein Leser / Hörer kann natürlich verschiedene Aspekte in einem Gleichnis finden, die er aus der geschilderten Bildwelt in seine Lebensrealität übersetzen könnte. Um dieses zu vermeiden, folgen hier eine Interpretationsanweisung und eine Interpretation aus dem Munde Jesu.
Der in Mk 4,35-6,56 anschließende Abschnitt erweist Jesus in aller Öffentlichkeit als Messias. Die sechs Wunder rund um den See Genezareth dienen als Zeichen seiner Messianität. Diejenigen, die bisher noch nicht vertrauen (glauben), können sich nun von Jesu Vollmacht überzeugen. Leitend für die Wundergeschichten sind die beiden Fragen in Mk 4,40: Was seit ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Diesen können die Hörer / Leser aus den folgenden Wundergeschichten schöpfen (Sturmstillung, Heilung des Besessenen von Gerasa, Auferweckung der Tochter des Jairus, Heilung einer blutflüssigen Frau, Speisung der 5000, Seewandel, Summarium über das Wirken Jesu).
Mit Mk 7,1-23 wendet sich der Autor einem Thema zu, das für das Verhältnis von Christen und Juden in der Zeit Jesu und des Urchristentums entscheidend war: die Reinheit des Menschen. Wie anhand von Jes 6 und der Tempeleinlassliturgien in Ps 15 und Ps 24,3-6 zu sehen ist, darf nur der reine Mensch mit Gott in Kontakt kommen. Der unreine muss bei der Gottesbegegnung sterben. Natürlich stellt sich für die Menschen, die Jesu Wirken miterleben, die Frage, dass wenn er der Messias ist, warum er sich dann mit den nach der geltenden jüdischen Lehre unreinen Menschen befassen kann. Zu dem, was rein und unrein ist, nimmt Jesus in Mk 7,1-23 Stellung. Einen besonders schwierigen Fall stellt schließlich der Kontakt mit der Syrophönizierin in Mk 7,24-30 dar. Sie gehörte nicht zur jüdischen Bevölkerung und galt daher per se als unrein. Mit dem zweiten Speisungsbericht in Mk 8,1-9 schließt diese Einheit ab.
Die folgende Auseinandersetzung mit den Pharisäern leitet zum Abschluss es ersten Teils des Mk über. In diesem Teil nimmt Markus dazu Stellung, welche Bedeutung das Leiden Jesu für den Glauben der ihm nachfolgenden Jünger und Gemeinden hat. Am Anfang dieses Teils steht zunächst die Warnung vor Gruppen, die die Gemeinden angreifen können (synonym für alle von außen kommenden Gefahren werden hier die Phariäser und Herodes genannt). Einen entscheidenden Erkenntnisfortschritt stellt schließlich das Bekenntnis des Petrus dar: Er erkennt in Jesus den Messias. Welcher Leser / Hörer es bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht verstanden hat, dem wird es nun auf den Kopf zugesagt.
Auf die Feststellung des Petrus gebietet Jesus seinen Jünger, dieses Wissen für sich zu behalten, da ansonsten die Erfüllung der Zeit (vgl. Mk 1,15), die sich im Leiden Jesu äußern wird, gefährdet ist. Den Lesern wird damit erklärt, warum Jesus, obwohl es doch offensichtlich war, den Weg des Leidens gehen musste. Er kündet sein Leiden nun drei Mal an (Mk 8,31-33; 9,30-32 und 10,32-34).
Nach der ersten Leidensankündigung wird Jesus schließlich sein heilsgeschichtlicher Ort zugewiesen: Er gehört zu den großen Gestalten Israels und wird mit der Aussage: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, noch vor Mose und Elia gestellt. Aus dieser Reihenfolge wird eine Entwicklung abgeleitet, an deren Ende Jesus steht: Während Mose, obwohl er der große Diener Gottes war, sterben musste und begraben wurde, entging Elia zunächst dem Tod, wurde lebendig entrückt, wurde aber nach seiner Wiederkehr ermordet (erinnern Sie sich daran, dass Johannes der Täufer in den Evangelien als der wiedergekehrte Elia verstanden wird). Jesus wird schließlich den Tod durchleben und auferstehen. Dieses wird das entscheidende Zeichen seiner Messianität sein (Mk 9,2-13).
Den Abschluss der Verkündigung in Galiläa bildet die Frage nach dem rechten Verhalten nach Jesu Tod. Dabei steht zunächst die Rangfolge der Jünger zur Debatte (Mk 9,33-37), anschließend der Umgang mit Menschen (Wundertätigkeit der Jünger in Mk 9,38-41), und schließlich eine Warnung vor dem Abfall von der Lehre.
Mit dem in Mk 10,1 vermerkten Ortswechsel machen sich Jesus und seine Jünger auf den Weg nach Jerusalem. Auf diesem gibt Jesus seinen Jüngern Regeln für das Zusammenleben der Gemeinde. Das Thema, wie sich das gemeindliche Leben nach seinem Tod gestalten soll, wird hier also direkt mit dem Weg Jesu zu seiner Todesstätte verknüpft. Mit den Regeln wird der markinischen Gemeinde deutlich, dass sie in einem direkten Kontinuum zur Wirksamkeit Jesu steht. Die Regeln, die ihr Leben bestimmt, sind von ihm gegeben. Im einzelnen handelt es sich um Folgendes: Ehescheidung (Mk 10,1-12), Segnung der Kinder als Vorbild der Nachfolge (Mk 10,13-16), irdischer Besitz und das Leben in der Gemeinde (Mk 10,17-27), Streit um die Rangordnung unter den Nachfolgern (Mk 10,35-45).
Abgeschlossen wird die Wanderung nach Jerusalem mit der Heilung des Blinden bei Jericho (Mk 10,46-52). Hier nahm der Evangelist Markus eine Lokaltradition aus Jericho auf und verortete sie in seinem geographischen Aufriss. Die Erzählung steht allerdings in keiner inhaltlichen Verbindung zu den zuvor stehenden Regeln für das Gemeindeleben.
Mit dem vierten Teil schließt das Mk ab. Die Erzählung läuft von nun an auf die Passion zu, wobei Jesus zuvor noch seine Botschaft an dem öffentlich entscheidenden Ort verkündet: im Tempel. Dort finden sechs Streitgespräche mit Theologen der damaligen Zeit statt. Vor diesen Streitgesprächen steht der Einzug Jesu nach Jerusalem (Mk 11,1-11) und die Tempelreinigung (Mk 11,12-25).
Mit Mk 11,27 setzen die Streitgespräche ein: 1. Die Frage nach der Vollmacht Jesu (Mk 11,27-33); 2. Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern (Mk 12,1-12); 3. Die Frage der Pharisäer nach den Steuern (Mk 12,13-17); 4. Die Frage der Sadduzäer nach der Auferstehung (Mk 12,18-27); 5. Die Frage der Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot (Mk 12,28-34) und 6. Jesus und die Davidssohnschaft des Messias (Mk 12,35-37). Abschließend warnt Jesus seine Anhänger vor den Schriftgelehrten (Mk 12,38-40). Die Warnung findet in der Erzählung über das Scherflein der Witwe ein passendes Beispiel.
In Mk 13 findet sich ein traditionsgeschichtlich eigenständiger Abschnitt, in dem Jesus über die kommende Endzeit redet. In ihm findet die Hoffnung der markinischen Gemeinde über die Art, wie das Gottesreich in Kürze anbrechen werde, ihren Ausdruck (Parusienaherwartung). Entsprechend der in der jüdischen Apokalyptik erscheinenden festen Zeitenfolge gibt es eine feste Reihenfolge der endzeitlichen Ereignisse. Diese legt Jesus in Mk 13 dar:
1. Das Ende des Tempels (Mk 13,1f.)
2. Das endzeitliche Szenario (Mk 13,3-23), in der das Evangelium in großer Gefahr verkündet werden muss (Mk 13,10f.)
3. Das Kommen des Menschensohns (Mk 13,24-27)
4. Mahnung zur Wachsamkeit, um die entscheidenden Zeichen für den Beginn der Endzeit nicht zu übersehen (Mk 13,28-37).
An die Endzeitrede schließt sich die Markus wohl schon in schriftlicher Form bekannte Passionsgeschichte, also die Erzählung über Leid und Tod Jesu, an. Der Ablauf der Erzählung ist in allen synoptischen Evangelien vorhanden, auch wenn Mt und Lk die markinische Version abgeändert bzw. ergänzt haben. Die Erzählung beginnt in Mk 14,1f. mit dem Plan, den der Hohepriester und die Schriftgelehrten fassen. In Mk 14,3-9 wird Jesus von einer Frau vor den Toren Jerusalems gesalbt. Diese Salbung ist als Vorwegnahme seiner Totensalbung zu verstehen. So schließt sich an die Salbung die Abmachung zwischen Judas und dem Hohenpriester an (Mk 14,10f.), die schließlich zur Verhaftung Jesu führt (Mk 43-52). Vor der Verhaftung Jesu findet in Mk 14,12-25 das letzte Abendmahl und anschließend Jesu Vorhersage der Verleugnung seiner Person durch Petrus statt (Mk 14,26-31). Nach dem Essen macht sich Jesus nach Gethsemane auf (Mk 14,32-42), wo er dann schließlich verhaftet wird. Den Abschluss von Mk 14 bildet schließlich die Vernehmung Jesu vor dem Hohen Rat (Mk 14,53-65) und die Verleugnung durch Petrus (Mk 14,66-72).
Das 15. Kapitel erstreckt sich schließlich von der Vernehmung Jesu vor Pilatus (Mk 15,1-5), über seine Verurteilung und Verspottung (Mk 15,6-20a) und seine Kreuzigung und sein Sterben (Mk 15,20b-41) bis zu seiner Grablegung in Mk 15,42-47.
Ihren Abschluss findet die Erzählung der Passion Jesu mit dem Auffinden des leeren Grabes in Mk 16,1-8. Die das Evangelium abschließenden Verse 9-20 sind sekundär angehängt (zweiter Markusschluss) und verweisen lokal wieder nach Galiläa zurück. In ihnen findet sich sowohl der Abschluss des Evangeliums (mit der Offenbarung Jesu vor den Jüngern in Mk 16,12.14), als auch der Auftrag an die Gemeinde, die Lehre und das Wirken Jesu weiterzutragen (Mk 16,15).
Neben dem bibelkundlichen Überblick sind die theologischen Leitlinien des Evangeliums von besonderer Bedeutung, so dass sie im Folgenden in gebotenter Kürze ausgeführt werden:
Die Evangelien bieten nicht einfach eine biographische Darstellung des Lebens Jesu, sondern sie stellen das Leben Jesu unter verschiedenen, für die Autoren und ihre Gemeinden wichtigen Aspekten dar. Sie sind also aus der Perspektive des Glaubens an Jesus und der aus diesem Glauben resultierenden Praxis entstanden. Dabei dienen sie als Reflexion gemeindeinterner Probleme auf dem Hintergrund der überlieferten Jesus-Geschichte. Lösungsvorschläge, die in den Evangelien gemacht werden, erhalten also eine gewichtige Autorität - sie wurden von Jesus selber so gegeben.
Ein besonders wichtiges Problem stellt die Verarbeitung der Hinrichtung Jesu, des von Gott gesandten Retters dar. Die das MkEv prägende Frage ist: Wie konnte es dazu kommen, dass der Retter von denen, die er retten wollte, hingerichtet wurde? Diese Frage beantwortet der Autor des Evangeliums mit zwei Aspekten:
a. Das Messiasgeheimnis: Jesus legt seinen Jüngern mehrfach ein Schweigegebot auf, nicht über das, was sie mit ihm erlebt haben oder was sie von ihm gehört haben, zu reden (ebenso gebietet er auch den Dämonen, über seine Existenz zu schweigen). Aus dieser Beobachtung am Text wurde die These des Messiasgeheimnisses erhoben. Es geht hier darum, die Spannung von Verhülltsein und Macht Jesu aufrecht zu erhalten und seine wunderwirkende Macht an seinen Leidensweg zurückzubinden: Leiden und Messianität gehören zusammen. Jesu Messianität wird also durch das Leiden nicht in Frage gestellt, sondern nur weil er leiden wird, erweist er sich als der Messias.
b. Die Leidensankündigungen: Die skandalöse Hinrichtung Jesu wird als göttlicher Plan gedeutet. Das entscheidende Wort in diesem Zusammenhang ist das gr. dei (es muss sein). Der Tod Jesu ist Teil des göttlichen Endzeitplans, die Menschen sollen und dürfen ihn nicht durchkreuzen. Bei diesen Leidensankündigungen handelt es sich um Bekenntnisaussagen der christlichen Gemeinde: Jesu Weg kann nur vom Leiden verstanden werden. Gerade im Kontrast zwischen dem irdischen Leiden und der Auferstehung liegt der Unterschied zwischen der Zeit heute und der erwarteten Heilszeit.
Ebenso wichtig ist die Frage nach dem aktuellen christlichen Leben: Wie haben sich Christen untereinander und in Auseinandersetzung mit jüdischen Menschen zu verhalten? Immerhin teilen die Christen ihre heilige Schrift, das Alte Testament, mit dem Judentum. Wie soll man nun richtig mit diesem umgehen? Das Mk gibt in Mk 7-10 verschiedene Verhaltensregeln vor. In ihnen finden sich die für die Christen verbindlichen Lebensregeln.
Abschluss: Das MkEv bietet einen christologischen Entwurf als Erzählung. Jesus predigt und handelt als vollmächtiger Sohn Gottes bereits seit seiner Taufe. Gerade wegen seiner Vollmacht wird er Opfer der weltlichen und religiösen Autoritäten. Die Auferstehung dient als Bestätigung des Weges Jesu. Sie ist das erwartete Zeichen, dass die neue Zeit anbricht. So erhält Jesus verschiedene Titel, die ihn im Sprachgebrauch des antiken Judentums als den erwarteten Retter, mit dem die Endzeit anbrechen wird, kennzeichnen: Sohn Gottes (aus Ps 2; 110), Messias und Menschensohn (aus Dan 7,13; Hen).
Der Titel Menschensohn drückt die Spanne aus, in der der Autor des Mk die Geschichte Jesu sieht: Die Worte vom irdischen Wirken des Menschensohns sind geprägt von Niedrigkeit (Leiden in Mk 8,31; 9,31; 10,33f.; Dienst in Mk 10,45) und von Hoheit (Vollmacht über Sünden und Sabbath in Mk 2,10; 2,28). Die Worte vom Kommen des Menschensohns (Mk 8,38; 14,52) zeigen seine eschatologische Funktion als Richter an. Der Titel Menschensohn bezeichnet aber NICHT die menschliche Natur Jesu.
Aufgabe 28: Lesen Sie Mk 1,1-15.
Aufgabe 29: Lesen Sie die 5 Streitgespräche Jesu mit den jüdischen Gruppen seiner Zeit (Mk 2,1-3,6).
Aufgabe 30: Lesen Sie den Abschnitt Mk 4,1-32 und denken Sie darüber nach, wie man die Gleichnisse auch hätte verstehen können. Was sagt dann der Interpretationsvorschlag Jesu über das kommende Gottesreich aus?
Aufgabe 31: Lesen Sie die Erzählung von der Verklärung Jesu (Mk 9,2-13) und geben Sie besondere Acht auf die Rolle der Jünger.
Aufgabe 32: Lesen Sie die Kapitel Mk 11f. und prägen Sie sich ein, welche Frage Jesus mit welcher Gruppe diskutiert.
Aufgabe 33: Lesen Sie die Endzeitrede in Mk 13.
Aufgabe 34: Lesen Sie mit den Kapiteln Mk 14-16 die Erzählung von der Passion und Auferstehung Jesu. Behalten Sie den Ablauf im Kopf.

Am See Genezareth