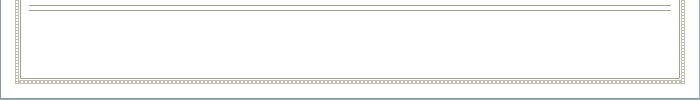Matthäus


Matthäus

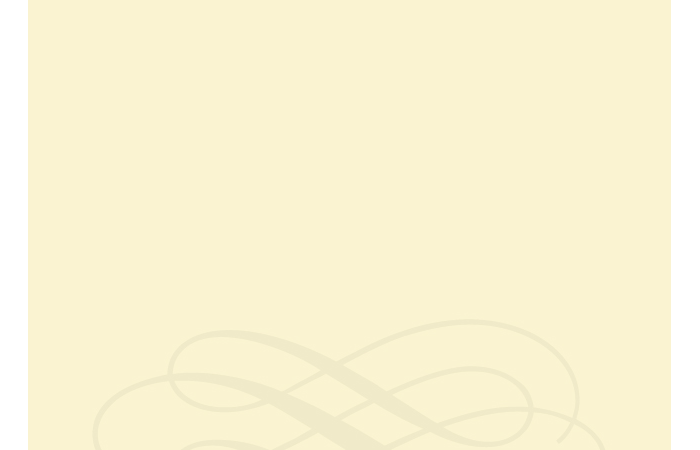
Matthäus
Das Mt beginnt mit einer Reflexion darüber, woher Jesus stammt. Er wird durch einen Stammbaum direkt von David und dieser wiederum in direkter Linie von Abraham abgeleitet. Dabei wird die Volksgeschichte Israel in drei gleich große Teile geteilt: Alle Glieder von Abraham bis zu David sind vierzehn Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind vierzehn Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind vierzehn Glieder (Mt 1,17). Die entscheidenden Ereignisse ergeben sich also mit jeder vierzehnten Generation. Auf den Stammbaum in Mt 1,1-17 folgt die Erzählung von der Geburt Jesu (Mt 1,18-25) und die Ankunft der Weisen aus dem Morgenland (Mt 2,1-12) über die Flucht nach Ägypten (Mt 2,13-15), den Kindermord des Herodes (Mt 2,16-18) und die Rückkehr aus Ägypten bis zu Johannes dem Täufer (Mt 3,1-12) und die Taufe Jesu (Mt 3,13-17) bis zur Versuchung Jesu in seiner 40-tägigen Wüstenzeit (Mt 4,1-11).
Auch das Mt gliedert seinen Stoff geographisch. Seine Wirksamkeit beginnt Jesus in Galiläa (Mt 4,12-13,58). Diese Wirksamkeit lässt sich in verschiedene Sammlungen untergliedern, die thematisch jeweils geschlossen sind. Nach dem Beginn der Wirksamkeit Jesu in Galiläa (Mt 4,12-17), der Berufung der ersten Jünger (Mt 4,18-22) und einer ersten Krankenheilung (Mt 4,23-25) folgt in den Kapiteln Mt 5-7 eine erste große Rede zur Unterweisung der Gemeinde. Diese erste große Rede wird als die Bergpredigt bezeichnet, da Jesus im Anblick der großen Volksmenge auf einen Berg steigt, um zum Volk zu reden. Die Bergpredigt untergliedert sich wiederum in folgende Abschnitte:
5,1f. Beginn mit einer redaktionellen Überleitung: Jesus lehrt wie ein Rabbiner
5,3-12 9 Seligpreisungen
5,13-16 Jüngerparänese: Ihr seid das Salz der Erde / Licht der Welt
5,17-20 Über die fortbestehende Gültigkeit des Gesetzes
5,21-48 6 Antithesen: Ihr habt gehört ...., ich aber sage Euch ...
5,21-26 Über das Töten und Zürnen
5,27-30 Über den Ehebruch
5,31f. Über die Ehescheidung
5,33-37 Über das Schwören
5,38-42 Über das Wiedervergelten
5,43-48 Über die Feindesliebe
6,1-18 Die richtigen Formen der Frömmigkeit
6,1-4 Vom Almosengeben
6,5-15 Vom Beten (darin 6,7-13 das Vaterunser)
6,16-18 Vom Fasten
6,19-34 Gegen den Dienst für falschen Lohn und falsches Sorgen
7,1-11 Paränetische Einzelsprüche
7,12 Die Goldene Regel
7,13-27 Eine Warnung vor der Nichterfüllung des mit der Bergpredigt gegebenen Auftrags
An die Bergpredigt schließt sich von Mt 8,1-9,37 eine Sammlung von Wundern an, die allein von einer Reflexion über den Ernst der Nachfolge Jesu in Mt 8,18-22, von der Berufung in Mt 8,9-13 und der Frage der Johannesjünger nach den Fastenregeln in Mt 8,14-17 unterbrochen wird.
In Mt 10 dreht sich alles um die Frage der Rolle der Jünger. Die sog. Aussendungsrede blickt über den Tod Jesu hinaus in die Zeit der selbständigen christlichen Gemeinden. Das Leben dieser Gemeinden und ihrer Mitarbeiter wird in Mt 10 reflektiert, wobei ihr innerer Zustand als Erfüllung dessen gedeutet wird, was Jesus bereits vorhergesagt hat (Verfolgung in Mt 10,16-26 und Entzweiung in Mt 10,34-39). Die Kapitel Mt 11 und 12 stehen unter dem Thema: Unglaube und Feindschaft der Umwelt Jesu. Dabei werden verschiedene Gruppen erwähnt, die der Jesus-Bewegung kritisch gegenüber standen: Johannes der Täufer und seine Jünger (Mt 11,1-19); die Bewohner der Städte Galiläas (Mt 11,20-24), die Pharisäer (Mt 12,1-8.9-14.38-42) und Jesu leibliche Verwandte (Mt 12,46-50). Abgeschlossen wird die Wirksamkeit Jesu schließlich mit der Gleichnisrede vom Reich Gottes in Mt 13. Doch endet die Wirksamkeit Jesu in Galiläa nicht freiwillig, sondern er wird von den Besuchern der Synagoge in Nazareth vertrieben.
Bevor Mt von der Wanderschaft Jesu in und um Galiläa berichtet, stellt er die Ermordung Johannes des Täufers dar (Mt 14,1-12). Mit Mt 14,13 setzt dann eine Sammlung von Wundergeschichten ein, die ihren Abschluss erst in Mt 15,32-39 mit der Erzählung von der Speisung der 4000 findet. Zwischen dem Wunderbericht in Mt 14,-34-36 und dem summarischen Bericht über weitere Heilungen in Mt 15,29-31 behandelt Mt das Thema der Reinheit bzw. der Unreinheit an der Erzählung von einem Streitgespräch mit Pharisäern (Mt 15,1-20) und der Erzählung von der kanaanäischen Frau in Mt 15,21-28.
Die folgenden Kapitel Mt 16 und 17 behandeln hauptsächlich das Thema der Messianität Jesu. Wichtige Texte in diesem Abschnitt sind das Petrusbekenntnis und Verheißung an Petrus in Mt 16,13-19, die beiden Leidensankündigungen in Mt 16,21-23; 17,22f. und die Verklärung Jesu in Mt 17,1-13. Abgeschlossen wird der Wanderbericht in Mt 18-20 mit Reflexionen über das Gemeindeleben und die Gemeindeorganisation. Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Gemeinderede (oder auch Gemeindeordnung) Mt 18, die das Grundprinzip der Brüderlichkeit zeigt:
18,1-5 Der Streit der Jünger um ihre Bedeutung im Himmelreich; Antwort Jesu: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.
18,6-14 Sorge um diejenigen in der Gemeinde, die sich zum Bruch der gemeindlichen Regeln verleiten lassen.
18,15-20 Über die Verbindlichkeit irdischer Handlungen und die Gegenwart Christi in der Gemeinde
18,21-35 Das Gleichnis vom Schalksknecht: Wie vergebe ich meinem Bruder?
Abgeschlossen wird der Abschnitt über die Gemeinde in Mt 20,1-16 mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, der dritten Leidensankündigung in Mt 20,17-19 und der Frage der Zebedaiden nach ihrer Bedeutung für den gestorbenen und auferstandenen Herrn. Gerade das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg macht deutlich, dass sich die Gemeindeglieder selber als solche verstehen. Sie hat wohl die Frage bewegt, wie Jesus mit den Menschen umgehen wird, die erst spät in ihrem Leben zur Gemeinde gestoßen sind und ob es im himmlischen Dasein eine Hierarchie geben wird.
Mit dem in Mt 21,1-10 geschilderten Einzug Jesu in Jerusalem beginnt die mt Darstellung der seiner letzten Tage, die sich bis zu den Auferstehungserzählungen in Mt 28 zieht. Auf den Einzug folgt in Mt 21,12-17 die Tempelreinigung, in Mt 21,18-22 das Zeichenwort vom verdorrten Feigenbaum und in Mt 21,23-27 die von den Hohenpriestern gestellt Frage nach der Vollmacht Jesu. An diese einleitenden Erzählungen, die dazu dienen, die Person und Sendung Jesu darzustellen, schließen sich die beiden Gleichnisse von den ungleichen Söhnen (Mt 21-28-32) und von den bösen Weingärtnern (Mt 21,33-46) an.
Das 22. Kapitel des Mt setzt sich mit den messianischen Lehren Jesu auseinander. Den Anfang macht hier das aus der Logienquelle Q stammende Gleichnis von der königlichen Hochzeit (Mt 22,1-14), an das sich die schon im Mk vorkommenden Fragen der jüdischen Gruppen anschließen (Steuer in Mt 22,15-22; Auferstehung in Mt 22,23-33; höchstes Gebot in Mt 22,34-40 und Davidssohn in Mt 22,41-46).
Die folgenden Kapitel Mt 23-25 bieten die Ankündigung des kommenden göttlichen Gerichts. Zielsetzung des Mt ist es, die Gemeinde auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten und jeder / jedem in der Gemeinde zu verdeutlichen, dass sie / er sich auf das Gericht vorbereiten und jederzeit damit rechnen muss. Zeichen des Beginns des Gerichts ist die Rückkehr Jesu (siehe das Gleichnis Mt 25,1-13 Von den 10 Jungfrauen)
Zunächst wendet sich Jesus aber gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer (Mt 23,1-36), bevor er über den Untergang Jerusalems klagt (Mt 23,37-39) und die Zerstörung des Tempels voraussagt (Mt 24,1f.). Diese Aussagen bewegen die Jünger dazu, Jesus nach den kommenden Ereignissen zu befragen und so herauszufinden, wie sie sich selber in dieser Situation verhalten sollen. Die Gleichniserzählungen Vom treuen und vom bösen Knecht (Mt 24,45-51), Von den 10 Jungfrauen (Mt 25,1-13), Vom anvertrauten Zentner (Mt 25,14-30) und Vom Weltgericht (Mt 25,31-46) bilden den Abschluss der Verkündigung Jesu. Nun folgt die Erzählung von Jesu Tod und Auferstehung.
Die Passionsgeschichte folgt dem aus dem Mk bekannten Aufriss, wobei Mt die einzelnen Abschnitte zum Teil etwas erweiterte, ohne insgesamt neue Abschnitte hinzuzufügen. In Kapitel 26 erzählt der Evangelist von den Ereignissen bis zur Verurteilung durch Pilatus. Kapitel 27 fährt dann mit der Erzählung von Jesu Tod fort. In diesen Ablauf hat Mt die Erzählung vom Ende des Judas hinzugefügt, in der er motivisch als Gottesfeind dargestellt wird (Mt 27,3-8). Seinen Abschluss findet das Evangelium mit den Auferstehungserzählungen in Mt 28. Mt 28,1-15 spielt noch in Jerusalem und bietet den Bericht vom leeren Grab. Mt 28,16-20 nennt als Ort der Erscheinung - vergleichbar dem sekundären Schluss des Mk - Galiläa als Ort der Erscheinung. Dort gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, seine Lehre mit der Botschaft seines Todes und seiner Auferstehung in die Welt hinauszutragen (Missionsbefehl Mt 28,18-20).
Das Mt ist in der kirchlichen Tradition der Alten Kirche das mit Abstand wichtigste Evangelium. Dieses erkennt man daran, dass es ganz am Anfang der neutestamentlichen Schriften steht. Entstanden ist es in der Zeit nach der Zerstörung des Tempels. Darauf weisen Mt 21,41; 22,7 und 23,38 hin. Da bereits Ignatius um 110 das Mt zitiert, wurde es auf jeden Fall vorher verfasst. Eine Datierung um 90 n.Chr. ist als wahrscheinlich anzusehen. Der Verfasser ist unbekannt, auch wenn der Titel nahe legt, er wäre einer der Herrenjünger gewesen. Warum ein Augenzeuge dann aber vor allem Quellenmaterial benutzt, ist unverständlich. Mt 13,52; 23,34 und der katechetische Umgang mit der Schrift (LXX) weisen darauf hin, dass der Verfasser des Ev ein frühchristlicher Lehrer war. In der Forschung ist bis heute umstritten, ob das Mt einen judenchristlichen oder einen heidenchristlichen Standpunkt einnimmt.
Für eine judenchristliche Zielgruppe des Evangeliums sprechen folgende Argumente:
a. das grundsätzliche Ja zum Gesetz (Mt 5,17-20; 23,3a.23b);
b. der permanente Rückgriff auf das AT und die betonte Anwendung des Erfüllungsgedankens (Mt 1,22f.);
c. die grundsätzliche Begrenzung der Mission Jesu auf Israel (Mt 10,5f.; 15,24);
d. die mt Gemeinde hält den Sabbath (Mt 24,20);
e. die mt Gemeinde lebt weiterhin im Verbund des Judentums (Mt 17,24-27; 23,1-3);
f. die vom Evangelisten gewählte Mosetypologie und die von ihm komponierten Reden lassen Jesus als Mose redivivus erscheinen.
Dagegen und damit für eine heidenchristliche Zielgruppe sind
folgende Argumente anzuführen:
a. der Heilsuniversalismus (Mt 28,18-20; 8,11f.; 21,43-45);
b. die Außerkraftsetzung der Ritualvorschriften (Mt 15,11.20b; 23,25);
c. mit der Kritik am Gesetz, die sich besonders in den Antithesen zeigt,
wird Jesus über die Autorität des Mose gestellt (Mt 5,21-48);
d. die Pharisäerpolemik (Mt 5,20; 6,1ff.; 9,9ff.; 12; 15; 23);
e. Mt vermeidet im Gegensatz zu Mk Aramäismen;
f. die heilsgeschichtliche Verwerfung Israels ist für Mt
bereits Realität (Mt 21,43; 22,9; 8,11f.; 27,25)
g. die rituellen Vorschriften zum Sabbath haben ihre
Bedeutung verloren (Mt 12,1-8);
h. die mt Gemeinde lebt in deutlichem Abstand zur
Synagoge (Mt 23,34b; 7,29b)
Es ist aber zu fragen, ob hier wirklich ein Gegensatz besteht.
Mt war ein Vertreter eines liberalen Diaspora-Judenchristentums,
das sich schon lange der Heidenmission geöffnet hatte. Die mt
Gemeinde kennt keine institutionalisierten Ämter (Mt 23,8-12),
hat aber Lehrer, Propheten und Schriftgelehrte. Eine besondere
Rolle spielt Petrus (Mt 10,2; 14,28-31; 15,15; 16,18f.; 18,21),
der immer wieder als Vorbild aller Jünger dient.
Fazit: Die Intention des Mt ist es, die Gründungsgeschichte der
Kirche aus Juden und Heiden zu erzählen.
Aufgabe 35: Lesen Sie den Beginn des Evangeliums und schreiben Sie auf, welche Elemente der Ihnen bekannten Weihnachtsgeschichte hier vorkommen und welche fehlen.
Aufgabe 36: Lesen Sie die Bergpredigt. Welche Teile des Ihnen aus der kirchlichen Praxis bekannten Vaterunsers kommen in der Mt-Version vor? Vergleichen Sie in der Konkordanz die Lk-Version und überlegen, welche Elemente aus welchem Gebet in das uns bekannte Gebet geflossen sind.
Aufgabe 37: Lesen Sie die Wundergeschichten! Fragen Sie sich, welche Funktion diese Erzählungen im Rahmen des MtEv haben?
Aufgabe 38: Lesen Sie die Aussendungsrede in Mt 10.
Aufgabe 39: Lesen Sie die Gleichnisrede in Mt 13. Welchen Sinn haben die Gleichnisse im Rahmen des MtEv? Was verrät die Interpretationshilfe in Mt 13,10-17 darüber?
Aufgabe 40: Lesen Sie die Gemeinderede in Mt 18.
Aufgabe 41: Welchen Gruppen wird welche Frage zugeordnet? Erinnern Sie sich an das, was Sie aus dem MkEv gelernt haben. Sollten Sie es nicht mehr wissen, schlagen Sie es dort nach oder lesen Sie Mt 22.
Aufgabe 42: Lesen Sie die Gleichnisse in Mt 24f. und prägen sich die Motive ein, mit denen das Kommen der Endzeit beschrieben wird.
Aufgabe 43: Lesen Sie die matthäische Darstellung der Passionserzählung.