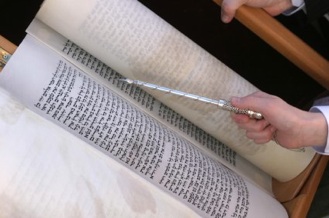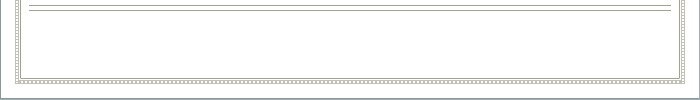Traditionsgeschichte


Traditionsgeschichte

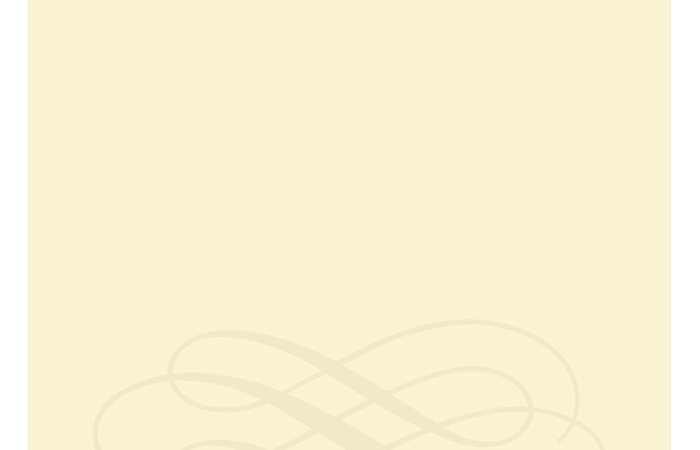
Zur Zielsetzung
Die traditionsgeschichtliche sowie auch die religionsgeschichtliche Arbeit dienen dazu, Assoziationsfelder zu erheben, die Hörer / Leser haben, wenn sie mit Texten konfrontiert werden. Zur Vermittlung solcher Vorstellungen verwenden Autoren Sprachkonventionen, die denen bekannt sind, die mit der Tradition vertraut sind. Mit diesen überlieferten Vorstellungen lässt sich zugleich auch herausstellen, für welchen Traditionszusammenhang ein Text verfasst wurde. Damit ist also die Aussage möglich, für wen ein Text geschrieben wurde. Bei der Exegese neutestamentlicher Schriften stellt sich häufig die Alternative für ein aramäisch-jüdisches oder ein griechisch-hellenistisches Publikum. Dabei gibt es mit dem Diasporajudentum durchaus eine Gruppe, die in beiden Traditionskreisen beheimatet war.
Wichtig bei der traditionsgeschichtlichen Arbeit ist es nicht nur, die Prätexte des zu bearbeitenden Textes aufzuzeigen, sondern darzulegen, wie ein Autor diese für seine eigene Botschaft nutzte. Überkommene Vorstellungen fließen nicht 1:1 in die neuen Texte ein, sondern werden den gegebenen Situationen und dem Aussageziel des Autors untergeordnet. Dadurch wird die Tradition aktualisiert. Und gerade hier wird das innovative Potential des Autors sichtbar.
Zur Methode
Für die traditionsgeschichtliche Arbeit ist es zunächst wichtig, tragende Begriffe und grundlegende Gedankenstrukturen herauszuarbeiten. Dabei ist es sinnvoll, die Begriffe nach Bildfeldern zu sortieren, um zu sehen, aus welchem Begriffsfeld der Autor Vorstellungen entlehnt. Zudem ist die Frage nach den Leitbegriffen des Textes wichtig. Sie prägen den Text und sind dementsprechend im weiteren Verlauf der Arbeit entscheidend.
Die Begriffsfelder und vor allem die Leitbegriffe sind in der Konkordanz nachzuschlagen. Die Konkordanz gibt Auskunft darüber, an welchen Stellen des Alten und des Neuen Testaments ein Begriff erscheint. Anschließend sind die Textstellen dahingehend zu überprüfen, ob sie dem Autor als Vorlage gedient haben können. Wichtig ist dabei, herauszustellen, welchen Bezug der gesamte so aufgefundene Text zum zu bearbeitenden Text hat. Reine Begriffs- oder Stichwortübereinstimmungen verraten i.d.R. nichts über eine Verwendung in dem zu untersuchenden Text.
Bei der Suche in der Konkordanz stößt man meist auf Texte des Alten und des Neuen Testaments, in denen der Begriff erscheint. In diesem Arbeitsschritt sind zunächst die alttestamentlichen Texte zu betrachten. Zwar stehen auch diese in einem traditionsgeschichtlichen Zusammenhang, der für die neutestamentliche Exegese jedoch meist von geringerer Bedeutung ist. Die Texte wurden zu neutestamentlicher Zeit bereits als Textcorpus verstanden und stehen so neben- und nicht nacheinander. Angaben über zeitliche Abfolgen, sollte das Alte Testament diese beinhalten, sind natürlich in Betracht zu ziehen.
Zum Beispieltext
Mt 8,5-13 ist durch zwei Begriffsfelder geprägt, die es nun zu betrachten gilt. Zunächst tritt mit der Erzählung vom Hauptmann und seinem Knecht ein Motiv in den Vordergrund, das auch im Alten Testament von Bedeutung ist: der Gehorsam.
In Dtn 27,10 findet sich eine grundsätzliche Aussage zum Gehorsam, die für das biblische Verständnis des Verhältnisses von Volk und Gott entscheidend ist: 9 Und Mose und die Priester, die Leviten, redeten mit ganz Israel und sprachen: Merke und höre zu, Israel! Heute, dieses Tages, bist du ein Volk des HERRN, deines Gottes, geworden. Und der HERR hat dir heute zugesagt, dass du sein eigen Volk sein sollst, wie er dir verheißen hat, so du alle seine Gebote hältst, 10 dass du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorsam seist und tust nach seinen Geboten und Rechten, die ich dir heute gebiete. In diesem Abschnitt aus den das deuternonmische Gesetz rahmenden Reden Mose wird die Stellung von Gott und Israel deutlich: Gott ist derjenige, der das Gesetz gibt, das Volk ist dasjenige, das das Gesetz zu halten hat. Die Gehorsamkeitsforderung wird zusammen mit der Bundeszusage gegeben, was wiederum bedeutet, dass Gehorsam gegenüber Gott der vom Volk zu leistende Teil des Bundes mit Gott ist.
Die Auswirkungen des Gehorsams werden in Dtn 28,13f. benannt: 13 Und der HERR wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst oben schweben und nicht unten liegen, darum dass du gehorsam bist den Geboten des HERRN, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun, 14 und nicht weichst von irgend einem Wort, das ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du andern Göttern nachwandelst, ihnen zu dienen. Mit dem Gehorsam gegenüber Gott wird dem Volk eine führende Stellung zukommen. Diese wird entsprechend Dtn 6,4f. an die Einzigkeit Gottes für Israel als entscheidendes Kriterium gebunden; der Dienst für andere Götter ist untersagt.
In Ps 81,14-17 wird der Gehorsam gegenüber Gott mit einer Heilszusage verbunden, die auf eine Exoduserfahrung weist: 14 Wollte mein Volk mir gehorsam sein und Israel auf meinem Wege gehen, 15 so wollte ich ihre Feinde bald dämpfen und meine Hand über ihre Widersacher wenden, 16 und denen, die den HERRN hassen, müsste es wider sie fehlen; ihre Zeit aber würde ewiglich währen, 17 und ich würde sie mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Gehorsamkeit führt Israel nach Ps 81,14-17 zu ewigem Bestand und zur Ernährung mit den qualitativ hochwertigsten Gütern, die es im Alten Orient zu finden gab. Wilder Honig galt dort als Nahrungsmittel, mit dem Königskinder aufgezogen wurden. Dieser wird zur dauerhaften Speise der Israeliten werden, sollten sie auf Gottes Wegen wandeln. Der Bezug von Gehorsam und dem von Gott gestifteten Mahl wird hier schon deutlich. Dieser tritt in der Vorstellung von der eschatologischen Mahlgemeinschaft all derer, die von Osten und Westen kommen werden, hervor.
In den Regelungen des Deuteronomiums findet sich schließlich in Dtn 8,19f. eine Aussage über die Folgen von Gehorsam und Ungehorsamkeit, in der auch die Völkerwelt, aus der der Hauptmann stammt, betrachtet wird: 19 Wirst du aber den HERRN, deinen Gott, vergessen und andern Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet; 20 eben wie die Völker, die der HERR umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des HERRN, eures Gottes. Dtn 8,19f. droht als Strafe für die Missachtung des göttlichen Herrschaftsanspruches den Tod denjenigen an, die ihn missachten. Hierbei wird eine deutliche Scheidung erhoben: Die Völker sind per se ungehorsam und verehren Gott nicht, die Israeliten haben die Wahl, treffen allerdings auch die falsche Entscheidung. Mangelnder Gehorsam wird schließlich zum Tod führen.
Bedenkt man nun, dass der Hauptmann Jesus mit kyrios ,Herr‘ anredet und dass dieser Begriff in der LXX als Übertragung des Tetragramms verwendet wird, so ist der Bezug zu Gott deutlich sichtbar. In Mt 8,5-13 erkennt einer aus den Völkern - die nach Dtn 8,19f. Gott nicht verehren - Jesu Göttlichkeit an und bezeugt seinen Gehorsam, indem er über den Glauben, dass Jesus Kranke heilen kann, sogar die Fernheilung aufgrund eines Befehls für möglich hält. Ihm steht nach Ps 81,14-17 die Teilnahme am königlichen Mahl zu.
Diese wird in Mt 8,5-13 mit dem zweiten Leitbegriff verbunden, den es im Rahmen der Traditionsgeschichte zu betrachten gilt: der Glaube. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass sich Glaube als Substantiv nicht im Alten Testament findet. Glauben ist dort jeweils ein Vorgang, der auf ein bestimmtes Ereignis bezogen ist. Im Hebräischen ist Glauben eine Variation des Begriffes fest sein, der wiederum etwas mit der Dauerhaftigkeit eines Zustandes oder eines Vorganges zu tun hat. Dieses wird in Jes 28,16 deutlich: Darum spricht Gott der HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Dieser Grundstein, der in Zion errichtet wurde, ist der Eckstein des Tempels. Dieser dient als Unterpfand des göttlichen Schutzes, auf den die Israeliten im Zweifelsfall vertrauen sollen. Mit Jes 7,9b wird dann sichtbar, dass dauerhafter Bestand und Glauben ein Vorgang sind: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Mit dem Glauben an die göttliche Zusage wird in diesem Text der Fortbestand Jerusalems verbunden. Blickt man auf den gesamten Text Jes 7,2-9, so wird deutlich, dass es sich die Bestandsaussage auf das Vertrauen auf Gottes Schutz im Falle des Angriffes der Aramäer bezieht.
In Mt 8,5-13 wird die Vorstellung vom dauerhaften Bestand ebenfalls an ein Verhalten gebunden: Der Hauptmann zeigt ein Vertrauen, das so für Jesus in Israel noch nicht zu finden war. Dieses wird entsprechend Jes 7,9b zum Grund für dauerhaften Bestand erhoben.
Dieser wiederum wird sich in der Teilnahme am eschatologischen Mahl zeigen, wie es in Jes 25,6-8 dargestellt wird: 6 Und der HERR Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. 7 Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. 8 Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat's gesagt. Dieses Mahl, das nicht nur mit gutem Essen, sondern auch mit dem eschatologischen Trost für das Volk Israels verbunden sein wird, wird erst nach dem Gerichtsschlag Gottes gegen alle seine Feinde eingesetzt werden. Der vorausgehende Text Jes 24 zu sehen ist. Trennung von Gläubigen und Gottesfeinden mittels Gericht und anschließende Teilnahme am Mahl sind dabei als Geschehensfolge fest miteinander verbunden.
Anders als in Jes 24f. wird in Mt 8,5-13 eine eschatologische Trennung erwartet, die auch das Volk Israel betreffen kann. Diese werden mit dem Begriff Kinder des Reiches benannt, der als Gegensatz zu den Kommenden von Osten und von Westen verwendet wird.
Fazit: Die traditionsgeschichtliche Untersuchung zeigte, dass dem Text Mt 8,5-13 Regelungen aus dem Dtn sowie Motive des Buches Jes zugrunde liegen. Mit dem Dtn wird der Gehorsam gegenüber Gott betont. Jesus wird vom Hauptmann als kyrios ,Herr‘ bezeichnet, was auf die Göttlichkeit Jesu hinweist. Gegen Dtn 8,19f. sind die Völker nicht per se ungehorsam, sondern können nach matthäischem Verständnis sehr wohl zur rechten Gotteserkenntnis mit den aus ihr resultierenden Konsequenzen kommen. Dieses schlägt sich dann auch in der Aufnahme von Jes 24f. nieder. Dieser Text über das eschatologische Mahl und dem vorausgehenden Gericht trennt die Völkerwelt aufgrund des Gehorsams gegenüber Gott. Dieses gilt nicht für Israel, das als Ganzes zum Mahl geladen werden wird. Matthäus verändert dieses Bild, indem er die Teilnahme grundsätzlich und gegen jede Zugehörigkeit an den Glauben bindet.
Mit der Traditionsgeschichte setzt die diachrone Analyse des Textes ein. Von nun an steht die Frage im Vordergrund, aus welchen Quellen ein Autor schöpfte, um seinen Text zu verfassen. Dabei sind verschiedene Ebenen zu unterscheiden: Direkte Zitate sind ein sicherer Hinweis für eine Aufnahme. Daneben finden sich Anspielungen, die auf die Rezeption von Traditionen deuten. Diese weisen darauf hin, dass der Verfasser auf Vorstellungen zurückgreift, die in der Tradition so bekannt waren, dass die Hörer / Leser wussten, worauf er Bezug nimmt. Wichtig ist es, die Veränderung der Tradition aufzuzeigen, um zu verstehen, was der Autor Neues sagen möchte.