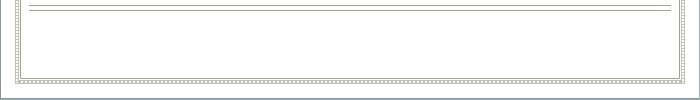Religionsgeschichtlicher Vergleich

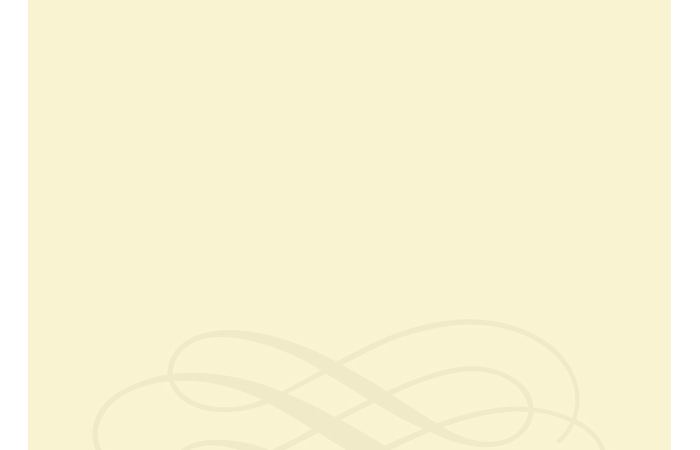
Zur Methode
Der religionsgeschichtliche Vergleich dient wie die zuvor behandelte Traditionsgeschichte dazu, Assoziationsfelder zu erheben, die Hörer / Leser haben, wenn sie mit Texten konfrontiert werden. Dabei unterscheidet sich die religionsgeschichtliche Arbeit in einigen wenigen Punkten von der traditionsgeschichtlichen.
Während in der Traditionsgeschichte Texte des Alten Testaments dahingehend befragt werden, ob sie einen Einfluss auf den neutestamentlichen hatten, werden zum religionsgeschichtlichen Vergleich Texte herangezogen, die aus der Umwelt des Neuen Testaments stammen. Zu diesen zählen zeitgenössische früh-jüdische Schriften als auch hellenistische Texte. Dabei ergeben sich Probleme, die im Bereich der Traditionsgeschichte noch nicht zu beobachten waren:
Zunächst ist zu bedenken, in welchem zeitlichen Verhältnis die Texte zueinander stehen. Sowohl die hellenistische als auch die früh-jüdische Literatur ist teilweise jünger als das Neue Testament. Jüngere Texte können natürlich auf ältere keinen direkten Einfluss gehabt haben. So ist also zunächst nach dem Alter der Texte zu fragen.
Danach ist die Verbreitung des Textes zu bedenken: Aus welcher Region stammt er und in welcher Form wurde er in der Antike verbreitet? Wenn er nur regionale Bedeutung hatte, ist überlegen, inwiefern es einen möglichen Austausch zwischen der Region, aus der er stammt, und der Entstehungsregion des neutestamentlichen Textes hatte. Lässt sich weder eine weitere Verbreitung des Textes noch eine Verbindung zwischen den beiden Regionen aufweisen, ist eine direkte Einflussnahme auszuschließen.
Anschließend ist nach der Art des Einflusses zu fragen: Besteht ein Einfluss in Form eines Zitates oder einer offensichtlichen Anspielung, bezeichnet man dies als direkten Einfluss, sofern der vergleichbare Text älter als der neutestamentliche ist. Ist er jünger, dann ist danach zu fragen, ob er vom neutestamentlichen Text abhängig ist und damit ein Teil seiner Wirkungsgeschichte. Von einer indirekten Einflussnahme spricht man dann, wenn die beiden Texte übereinstimmende Begriffe oder Motive aufweisen, dabei jedoch keine direkte literarische Abhängigkeit besteht.
Ist eine Einflussnahme der beiden Texte aufgrund fehlender Hinweise auf direkte Verbindungen ausgeschlossen, so lässt sich an den übereinstimmenden Motiven und Begriffen zumindest sehen, dass diese innerhalb der antiken Gesellschaft von so hoher Bedeutung waren, dass sie in unterschiedlichen Kontexten verwendet wurden. Es scheint sich die antike Kultur prägende Vorstellungen zu handeln.
Zum Beispieltext
Zu Mt 8,5-13 finden sich zwei Texte, anhand derer deutlich wird, auf welche geistesgeschichtlichen Vorstellungen der Verfasser zurückgriff: Zunächst wird von Rabbi Pinchas ben Chama (ca. 360 n.Chr.) überliefert: Wer einen Kranken in seinem Hause hat, der gehe zu einem Gelehrten, dass dieser für ihn um Erbarmen flehe. Da dieser Text zeitliche später entstanden ist und die Rabbinen bewusst nicht auf das Neue Testament verweisen, ist hier offensichtlich von einer allgemeinen Vorstellung im antiken Israels auszugehen, nach der es gelehrten Männern möglich war, durch die Bitte um Erbarmen Heilung hervorzurufen. Wo diese Bitte ausgesprochen werden musst und ob es sich dabei auch um eine Heilung von Ferne handeln konnte, wird nicht sichtbar.
Während der Text aus der rabbinischen Literatur allein auf eine gesellschaftliche Grundvorstellung hinweist, ist mit äthHenoch 108,3ff. eine direkte Parallele zum Text Mt 8,5-13 zu finden. Zur Gerichtsvorstellung gehört im apokalyptischen Ablauf auch das Ausscheiden der Verworfenen, bei denen dann Heulen zu hören sein wird. Das, was Jesus in dem eingeschobenen Abschnitt über die Kinder des Reiches sagt, ist ein Terminus, der in der apokalyptischen Literatur zu Hause ist und auf die eschatologische Scheidung von Gut und Böse hindeutet.