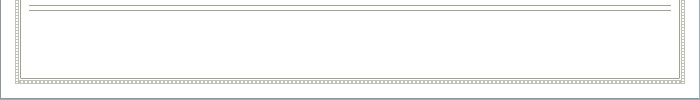Exegetische Methoden


Exegetische Methoden

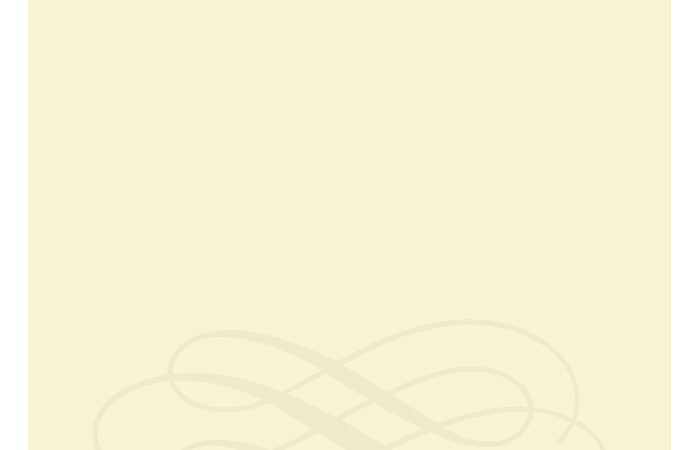
Die Geschichte der Exegese
Die exegetischen Methoden der historisch-kritischen Exegese wurden seit dem 18. Jh. n.Chr. entwickelt. Sie wurden nicht von Anfang an als geschlossener Methodenkanon entwickelt. Vielmehr sind sie aus einzelnen Textbeobachtungen heraus erwachsen. Sie sind jeweils Teil der Zeitgeschichte der Wissenschaft und damit Stück akademischer Kulturgeschichte.
Am Anfang der kritischen Auseinandersetzung christlicher Bibelwissenschaftler steht die Suche nach den Texten in ihren Ursprachen in der Reformationszeit. Zur Überwindung einer auf der lateinischen Bibelausgabe (Vulgata) basierenden kirchlichen Praxis wendeten sich reformatorische Theologen den Texten in ihren Ursprachen (Hebräisch und Griechisch) zu. Ihr Bestreben, das auf die Emanzipierung der Gläubigen zielte, ist Teil des Humanismus, der im Zuge der Wiederentdeckung antiker Kultur auch die Schriften dieser Zeit in ihren Originalsprachen rezipierte. Im Gegensatz zum im Katholizismus üblichen Zusammenstellung von biblischen Schriften in ihrer lateinischen Überlieferung und autoritativer Interpretation dieser durch die Kirchenväter legten die Reformatoren mit dem Grundsatz sola scriptura (allein die Schrift) ihren Schwerpunkt auf die Interpretation biblischer Schriften in Ursprachen. Dazu war es jedoch notwendig, diese wieder zu entdecken. Bezogen auf das Alte Testament war dieses recht einfach, da es in seiner hebräischen Form von Judentum bewahrt wurde und so zugänglich war. Anders war dieses beim Neuen Testament, das kirchlicherseits nur in lateinischer Überlieferung verwendet wurde. Luther griff für seine Bibelübersetzung auf die Edition des griechischen Neuen Testaments von Erasmus von Rotterdam zurück. Dieser hatte im Rahmen humanistischer Quellenkunde eine erste rekonstruierte Version veröffentlicht.
In der nachreformatorischen Theologie versteifte sich der Umgang mit den biblischen Schriften wieder. War die Zeit der Reformation auch von einem Forschergeist geprägt, der dem humanistischen ad fontes (zu den Quellen) entsprach, so wurden die Schriften der Reformatoren in den Zeiten der lutherischen Orthodoxie mit scholastischen Methoden erörtert und bekamen so den autoritativen Status, den im Katholizismus die Interpretation der Kirchenväter besaß. Erst der Pietismus im 17. Jh. v.Chr. veränderte den Umgang mit biblischen Schriften wieder. Während in Europa die Staatssysteme durch absolutistische Herrschaften geprägt waren, versammelten sich Christen jenseits der institutionell verfassten Kirche ihres Landesherren in Hauskreisen, in denen Bibeltexte besprochen und ausgelegt wurden. In diesen Zeiten wurden die ersten Beobachtungen gemacht, die später zur Bibelkritik führten. Noch waren die biblischen Schriften als geoffenbartes Wort Gottes unantastbar.
Dies änderte sich im 18. Jh. n.Chr. Der Hildesheimer Pfarrer Henning Bernhard Witter und kurze Zeit später auch Jean Astruc, Leibarzt des französischen Königs, veröffentlichten Kommentare biblischer Bücher, in denen sie die Einheitlichkeit biblischer Schriften bezweifelten. Bei ihnen finden sich die Grundlagen der Literarkritik. Sie beobachteten vor allem eine divergierenden Umgang mit Gottesbezeichnungen im Alten Testament sowie Spannungen, Widersprüche und Brüche in biblischen Erzählungen. Zwar wurden sie in ihrer Zeit kritisch angefeindet, die von ihnen aufgeworfenen Fragen ließen sich jedoch nicht mehr totschweigen.
Mit dem in ihrer Zeit anbrechenden Kolonialismus trat die Welt des Vorderen Orients zunehmend in das Bewusstsein Europas. Die weltweise Mission, die sich durch die aus dem Pietismus entwickelte, brachte nicht nur europäische Missionare, sondern auch Wissenschaftler mit fernen Kulturen in Kontakt. Daraus entwickelten sich neue Möglichkeiten im Umgang mit biblischen Schriften. Mit dem Anwachsen des verfügbaren Bestandes biblischer Handschriften wurde die genauere Rekonstruktion der Ursprungstexte möglich. Daneben wurde die von Witter und Astruc begründete Bibelkritik in Form der Literarkritik auf weitere Schriften ausgedehnt, so dass sich schon bald verschiedene Quellenschriften vor allem innerhalb des Alten Testaments erkennen ließen. Ab dem 19. Jh. n.Chr. wurden dann auch erste archäologische Ergebnisse in die Auslegung der Text mit einbezogen. Aufgrund der Ausgrabungsfunde in den biblischen Ländern wurde immer weiter deutlich, dass die Schriften des Alten und des Neuen Testaments Urkunden einer vergangenen Kultur sind, die im Rahmen kirchlicher und synagogaler Praxis tradiert wurden. Die sich mit den Schriftfunden im Orient ausbildende religionsgeschichtliche Schule zeigte, dass das Alte und das Neue Testament jeweils Bestandteil einer breiteren Kultur waren, aus der die Autoren schöpften. Spuren der Rezeption von Motiven und Vorstellungen ließen sich auch innerbiblisch finden, so dass neben der Religionsgeschichte auch die Traditionsgeschichte zum Bestandteil biblischer Exegese wurde.
Stärker auf die einzelnen Texte bezogen waren Analysen, die sich mit Formen und Gattungen auseinander setzten. Ab dem beginnenden 20. Jh. n.Chr. finden sich derartige Ansätze zunächst in der alttestamentlichen, später dann auch in der neutestamentlichen Wissenschaft. Grundgedanke der Exegeten war es, über die Formen und Gattungen der Texte mündliche Vorformen rekonstruieren zu können, auf denen das schriftlich Vorliegende basiert. Die Form- und Gattungsgeschichte nahm in den Nachkriegszeiten eine besondere Prägungen an: In der neutestamentlichen Exegese wurde mit der neueren Formgeschichten nach Klaus Berger der Versuch unternommen, die Texte in antike Kategorien einzuteilen, um ihre ursprüngliche Aussageintention bestimmen zu können. Die Form- und Gattungskritik wird so zu einem Teil der textpragmatischen Analyse erhoben. War es einstmals Ausgangspunkt der Forschung, die mündliche Vorform zu rekonstruieren, so wird sie heute vor allem zur Beschreibung der Aussageintention des Autors verwendet.
Eine weitere Entwicklung der Nachkriegszeit prägt die heutigen exegetischen Forschungen. Wurden in den Zeiten der aufkommenden Literarkritik vor allem die rekonstruierbaren Ursprungstexte betrachtet, so wendet sich die Forschung im Rahmen der Redaktionskritik mehr und mehr den Ergänzungsschichten zu. In der neutestamentlichen Exegese findet dieses aufgrund des nur geringen redaktionellen Textanteils nur in eingeschränktem Maße statt, in der alttestamentlichen Exegese wurde es jedoch zu einem wichtigen Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit.
Auch wenn die einzelnen Methodenschritte ihre historischen Ursprünge haben und damit zugleich die Zeiten benannt sind, in denen sie schwerpunktmäßig angewendet wurden, so werden sie in heutigen Zeiten immer weiter spezifiziert. Die textgeschichtliche Arbeit, zu der die Textkritik zu zählen ist, hat vor allem durch das Bekanntwerden der Qumranschriften in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine Renaissance erlebt, die weiter anhält. Doch wäre diese nicht ohne das Wissen um archäologische, redaktionsgeschichtliche und religionsgeschichtliche Zusammenhänge möglich. Im Vergleich zu ihren Anfängen zeichnet sich die heutige exegetische Arbeit vor allem durch ihre Komplexität in der Methodenanwendung aus.
Der Kurs Exegetische Methoden setzt sich aus fünf Teilen zusammen, die jeweils unterschiedliche Arbeitsschritte umfassen. An Beispielen aus alt- und neutestamentlichen Schriften wird Ihnen im Anschluss an die Beschreibung einer jeden Methode gezeigt, wie das zuvor abstrakt Dargestellt in der konkreten Textarbeit umgesetzt werden kann.