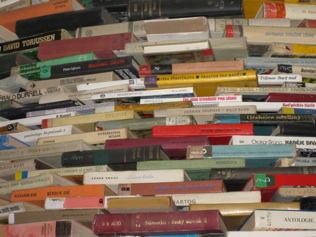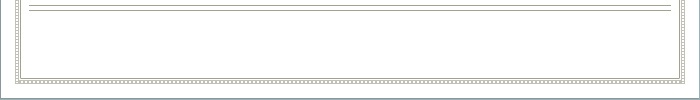Textlinguistik


Textlinguistik

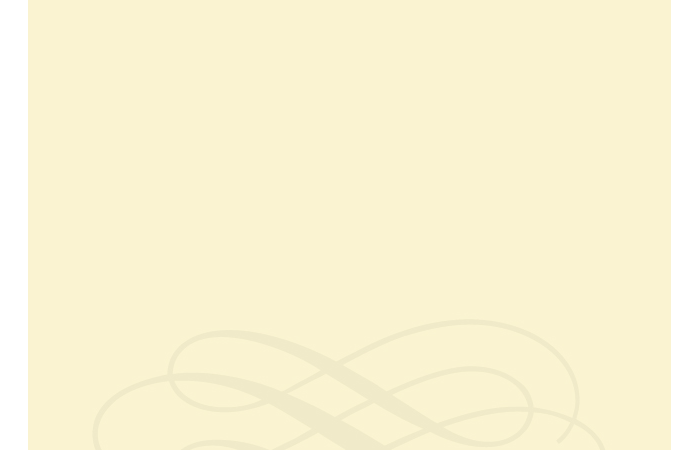
Gliederung des Textes
Am Anfang der Beschreibung des im vorherigen Arbeitsschritt bestimmten Textes steht die Gliederung. Mit ihr verschafft man sich einen Eindruck, wie der Text aufgebaut ist.
Eine Gliederung kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen: Sie kann sowohl am Inhalt als auch an der Funktion orientiert sein - sie darf aber nicht beide Ebenen beinhalten, da sonst die Struktur des Textes nicht eindeutig sichtbar wird. Dieses wird im Folgenden am Beispieltext expliziert:
a.Inhaltliche Gliederung von Mt 8,5-13:
V5f. Einleitung:
V5 Jesus kommt nach Kapernaum und trifft den Hauptmann
V6 Der Hauptmann berichtet vom Leid des Knechts
V7-9 Dialog zwischen Jesus und dem Hauptmann:
V7 Jesus sagt Heilung zu
V8f. Hauptmann bittet allein um eine Zusage
V10-12 Jesu Rede über den Glauben
V10 Jesus hat solchen Glauben in Israel noch nicht gefunden
V11 Ansage des Kommens von Fremden zum eschatologischen Mahl
V12 Verwerfung der Kinder des Reiches
V13 Abschluss: Der Knecht ist geheilt
b.Funktionale Gliederung:
V5f. Einleitung:
V5 Einführung des Ortes und der Handlungsträger
V6 Einführung in die Problematik
V7-9 Dialog:
V7 Zusage Jesu
V8 Selbstbeschreibung des Hauptmanns
V9 Handlungsmuster
V10-12 Monolog Jesu:
V10 Deutung des Erlebten
V11f. Ansage
V11 Ansage für kommende Völker
V12 Ansage für Israel
V13 Abschluss: Erfüllungszusage
Textkohärenz
An den beiden Gliederungsformen lässt sich bereits der Textverlauf erkennen, den es im Folgenden zu beschreiben gilt. Dabei sind eine Reihe an Fragen leitend:
1.Durch welche Text- und Strukturelemente wird der Text konstituiert?
2.Ist der Text aus einem Guss oder sind Nahtstellen erkennbar?
3.Auf welchen Aussagen liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Textes?
4.Wo und wieweit verlaufen Spannungsbögen?
5.Welches sind tragende Begrifflichkeiten bzw. semantische Felder?
6.Gibt es konstitutive Gegensatzpaare („Basisoppositionen“)?
7.Wie verhalten sich die Akteure zueinander?
8.Welche Gedankenverknüpfungen (Konjunktionen, Zeitadverbien...) sind erkennbar?
9.In welchem Tempus ist der Text gehalten, gibt es Tempuswechsel?
10. Wo wird knapp, wo wird ausführlich geschildert, wo begegnet direkte Rede?
11. Gibt es Wiederholungen, eventuell mit aufschlussreichen Detailveränderungen?
12. Wo sind inhaltliche Spannungen oder literarische Brüche erkennbar?
Diese Fragen lassen sich anhand der bereits dargestellten Struktur gut beantworten. Da es keine generellen, sondern allein auf den einzelnen Text bezogene Antworten gibt, liegen sie der exemplarischen Darstellung zugrunde:
Die Textabgrenzung hat bereits zwei wichtige Textelemente aufgezeigt. In der Einleitung werden die beiden handelnden Personen, der Ort der Handlung und die Problemstellung des Textes aufgezeigt. Der Ortswechsel wird durch ein Verb der Bewegung (hineingehen) und die Nennung des Ortes angezeigt, die Personen werden durch die Nennung ihres Namens bzw. ihres Standes eingeführt. Der Abschluss der Erzählung besteht aus einer Erfüllungszusage, die sich auf die Schilderung der häuslichen Situation des Hauptmanns (V6) und das von ihm aufgezeigte Handlungsmuster (V9) bezieht. Eine direkte Bitte um Heilung gibt es jedoch nicht.
Dieses leitet zur nächsten Beobachtung über. Das Gespräch zwischen dem Hauptmann und Jesus ist geprägt vom Vergleich, mit dem der Hauptmann Jesus eine Handlungsanweisung gibt. Auf die Hilfszusage Jesu reagiert er zunächst mit einer Unterwürfigkeitserklärung (V8) und dann mit einer Handlungsanweisung. So, wie er selber über seine Leute befehligt, so soll Jesus mit der Krankheit des Knechts umgehen. Daran wird die Stellung deutlich, die der Hauptmann Jesus einräumt: Er ist der Herr über die Krankheiten. Dieses drückt sich semantisch an der vom Autor gewählten Herrschaftsterminologie aus. Zu dieser gehört die Dienstbezeichnung des Hauptmanns, die Anrede, mit der er Jesus gegenüber tritt (,Herr‘), sowie die Begriffe ,Obrigkeit‘, ,Soldaten‘ und ,Knecht‘. All diese weisen auf hierarchische Vorstellungen hin, mit denen die Stellung der beiden Akteure in ihrem Umfeld beschrieben werden. Von der Problemstellung in V6, über die Hilfszusage Jesu in V7, die Unterordnung des Hauptmanns unter Jesus in V8, das Handlungsmuster in V9 bis hin zur Erfüllungsansage in V13 erstreckt sich so ein Spannungsbogen, der seinen Höhepunkt in der Erfüllungszusage findet. Verknüpft sind diese Teile durch die Einleitungen ,der Hauptmann sprach‘ V6, ,Jesus sprach‘ V7, ,der Hauptmann antwortete‘ V8 und ,Jesus sprach zu dem Hauptmann‘ V13. Erst mit der Erfüllungszusage ist der Dialog zwischen Jesus und dem Hauptmann beendet.
Aus diesem Zusammenhang heraus fällt der Monolog Jesu. In ihm knüpft er zwar an das vom Hauptmann vorgeschlagene Handlungsmuster an, doch wechselt Jesus die Ebene. Es geht nicht mehr um den Heilungsvorgang, sondern um die hinter dem Vorschlag stehende Intention des Hauptmanns. Dass der Hauptmann sich selber Jesus unterstellt und ihm die Möglichkeit aufzeigt, mittels Befehl die Krankheit zu beseitigen, deutet Jesus als Glauben. Dieses war bisher noch nicht zu sehen. Zudem wechselt Jesus die Sprechrichtung. War es im Dialog ein Austausch zwischen Jesus und dem Hauptmann, so wendet sich Jesus nun den ihm Nachfolgenden zu. Der in V10 genannte Glaube tritt im Kontext der Glaubensgemeinschaft auf. Aus diesem Wortfeld werden ,Israel‘, ,viele Kommende‘, ,Abraham, Isaak und Jakob‘, die ,Kinder des Reiches‘ und die ,Finsternis‘ verwendet. Sprachlich wird die Folge aus dem Glauben des Hauptmanns in eine Antithese gekleidet: V10 ,Jesus sprach‘, V11, ,Ich aber sage euch‘ V12. In der Antithese werden dann zwei Gruppen kontrastiert. Die ,vielen von Osten und Westen Kommenden‘ stehen den ,Kindern des Reiches‘ gegenüber. Erreicht wird dieses durch die Konjunktion ,aber‘ in V12. Damit wird ein erneuter Spannungsbogen erzeugt: Der Wahl der Vielen und damit der Ausweitung der Glaubensgemeinschaft steht die Verwerfung derer Gegenüber, die sich zu den Erwählten zählen.
Die besondere Stellung des Monologs Jesu im gesamten Text wird auch durch die Tempuswahl deutlich. Während das Präteritum als Erzählzeit dient, ist der Dialog weitestgehend im Präsens verfasst. Als Nachzeitigkeit dazu wird das Futur verwendet. Anders stellt sich der Monolog dar. In V10 wird das Perfekt zur Bezeichnung des Zustandes gebraucht, die aus der Beobachtung folgende Ansage steht dann im Futur.
Für die Textkohärenz ergibt sich damit Folgendes: Der Text besteht aus zwei miteinander verbundenen Einheiten, dem Dialog, der zur Heilung führt, und dem Monolog, in dem eine eschatologische Perspektive gezeichnet wird, die nur indirekt mit dem Heilungsgeschehen verbunden ist. Synchron betrachtet sind diese beiden Einheiten so miteinander verbunden, dass der Glaube und die damit einhergehende eschatologische Trennung der Gläubigen und der Nicht-Gläubigen aus der Rede des Hauptmanns abgeleitet werden. Das, was im Dialog faktisch auf den einzelnen Vorgang bezogen ist, wird im Monolog abstrahiert. Dazu ist eine doppelte Übertragung notwendig: Der Hauptmann gibt Jesus eine Handlungsanweisung, die er aus seinem täglichen Berufsumfeld ableitet. Jesus wiederum überträgt das Verhalten des Hauptmanns auf die Glaubensgemeinschaft, die ihm mit demselben Vertrauen (= Glauben) entgegentreten soll. Hinsichtlich der diachronen Textgestaltung ist festzuhalten, dass die Rede Jesu den Dialog und damit den Spannungsbogen durchbricht und der Text inkohärent wird. Es wird im Weiteren zu fragen sein, ob dies ein Anzeichen für ein Textwachstum ist. Dieses lässt sich jedoch erst im Rahmen der diachronen Analyse klären.
Textlinguistik
Textlinguistische Fragestellungen dienen dazu, die innere Kohärenz (Einheitlichkeit) und die Struktur (Gliederung) eines Textes zu erfassen. Damit bewegen wir uns bei diesem Arbeitsschritt an der Textoberfläche (synchrone Analyse). Auf diese Weise werden zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen vorbereitet: Die Beschreibung des Textes als Einheit, wie sie sich heute in den in der Bibel findet, und die Wahrnehmung des literaturhistorischen Wachstums des Textes (diachrone Analyse). Diese beiden in der Exegese verbreiteten Sichtweisen müssen strikt getrennt werden, da sie unterschiedliche Fragen an den Text beantworten.