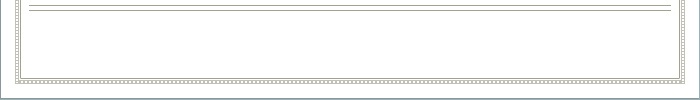Sozialgeschichte & Realien


Sozialgeschichte & Realien

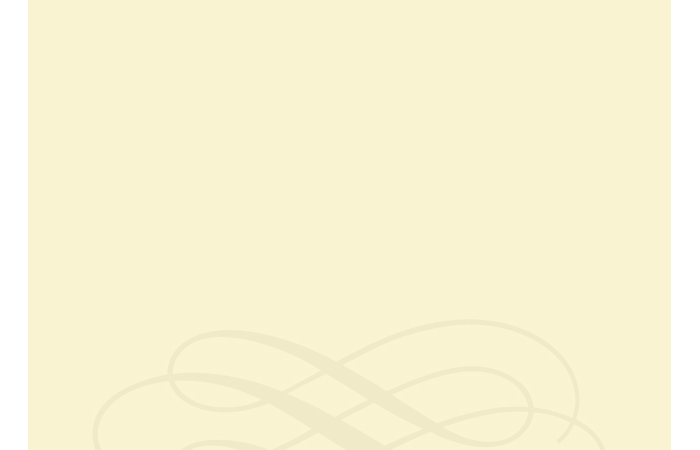
Sozialgeschichte und Realien
Zu den Begriffen: Die Sozialgeschichte setzt sich mit den soziologischen, politischen und ökonomischen Bedingungen zu untersuchender Zeiten auseinander. Ziel ist es, die gesellschaftlichen Bedingungen der erzählten Zeit darzustellen, um die Bedeutung des Textes in seiner erzählten Zeit einordnen zu können. Für biblische Texte heißt dies, dass die Bedeutung von Orten, Berufsständen, Umweltbedingungen etc. zu erheben ist.
Die Realienkunde ist ein Teil archäologischer Arbeit. In ihr wird die Frage nach der Beschaffenheit einzelner, in der Geschichte erwähnter Elemente gestellt wird. Ihr Aussehen und ihr Einsatz innerhalb der antiken Gesellschaft sind darzulegen.
Als Leitfragen für diesen Arbeitsschritt sind vor allem die folgenden beiden zu nennen:
Welche Begriffe müssen für das Verständnis des Textes geklärt werden?
Welche lebensweltlichen Verhältnisse u. Problemstellungen sind erkennbar?
Diese Fragen beantworten sich nicht ohne die Hilfe einschlägiger Literatur, da sie über den Text selber hinausgehen. Als Sekundärliteratur stehen verschiedene sozialgeschichtliche Standardwerke zur Verfügung, von denen vor allem Neues Testament und Antike Kultur (NTAK) zu nennen ist. Des Weiteren geben Realenzyklopädien (wie etwas die TRE, die RGG oder das LCA) Auskunft über einzelne Phänomene. Sehr zu empfehlen sind auch die Bibellexika, unter ihnen vor allem das NBL (Neues Bibellexikon) und das Internetlexikon www.wibilex.de, das Informationen zu Altem und Neuem Testament erhält.
Zum Beispieltext: Bei der Analyse von Mt 8,5-13 sind verschiedene Begriffe von Bedeutung, die auf ihre sozial- und kulturgeschichtlichen Hintergründe hin zu untersuchen sind. Zunächst ist der Blick auf den Ort Kapernaum zu richten. Dieser liegt am See Genezareth und gehört zusammen mit Chorazin und Betsaida zu den Städten in Galiläa, zwischen denen Jesus als Wanderprediger hin und her zog. Geprägt ist die Region von der Landwirtschaft und dem Fischfang. Zur Administration gehören religiöse Autoritäten, die an den örtlichen Synagogen beschäftigt waren, sowie galiläische Zolleinnehmer und Repräsentanten des römischen Militärs. Die Fremdherrschaft in Galiläa führte bei Missernten schnell zur Verarmung der Landbevölkerung, da die Steuerlast durch geminderte Einnahmen zu hoch wurde, was wiederum Landflucht bewirkte. Durch diese befanden sich in den Städten Besitz- und Erwerbslose, die im NT als Bettler in Erscheinung treten. Schlechte Ernährung und eine höhere Verbreitung von Krankheiten führten auch zu einer erhöhten Anzahl an Kranken. Auch diese treten im NT mehrfach in Erscheinung.
Mit zu den Repräsentanten der Fremdherrschaft gehört der im Text erwähnte Hauptmann. Die deutsche Bezeichnung spiegelt seine hohe Stellung innerhalb des Militärs wieder. Als Centurio war der Hauptmann Befehlshaber über eine ca. 100 Mann starke Abteilung, die in Kapernaum stationiert war und dort die römische Besatzungsmacht vertrat. Diese hohe Stellung des Hauptmanns kommt auch im Dialog zum Ausdruck, wenn er seine Befehlsgewalt betont. Einer seiner Untergebenen ist der kranke Knecht. Dieser Begriff, der als deutsche Übersetzung des griechischen pais nur einen Teil der Bedeutung der Ursprungswortes wiedergibt, wird sowohl für Knechte, für junge Männer, als auch für männliche Nachkommen (Sohn) verwendet. Dass es sich um einen leiblichen Nachkommen handelt, ist eher unwahrscheinlich, für dieses wird i.d.R. der griechische Begriff uios gebraucht. Vielmehr scheint es sich um eine Person zu handeln, die in einem besonderen Vertrauensverhältnis zum Hauptmann steht - er lebt in seinem Haus - und als eine Art persönlicher Assistent beschäftigt wurde.
Neben diesen den Text tragenden Begriffen mit sozialgeschichtlicher Bedeutung treten die Vorstellungen vom eschatologischen Mahl mit den Erzvätern und der Glaubensbegriff in den Vordergrund des Textes. Diese theologischen Vorstellungen sind ohne eine traditionsgeschichtliche Untersuchung sozialgeschichtlich nicht beschreibbar, so dass die Frage nach ihrer Bedeutung erst in diesem Zusammenhang gestellt und dann auf die Sozialgemeinschaft bezogen werden kann.
In diesem Arbeitsschritt wird die historische Dimension der erzählten Zeit betrachtet. Für die weitere Textanalyse ist es wichtig, Informationen über die dem Text zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen, über die Stellung der einzelnen Akteure und über die Bedeutung der im Text behandelten Phänomene und / oder Gegenstände zu sammeln. Ziel ist es, ein detailgetreues Bild der erzählten Geschichte zu erhalten. Dabei sind alle soziologischen und historischen Informationen von Relevanz, die helfen, den Text in seiner erzählten Zeit zu beschreiben.