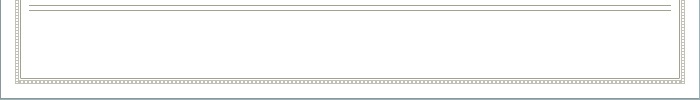Pragmatische Analyse


Pragmatische Analyse

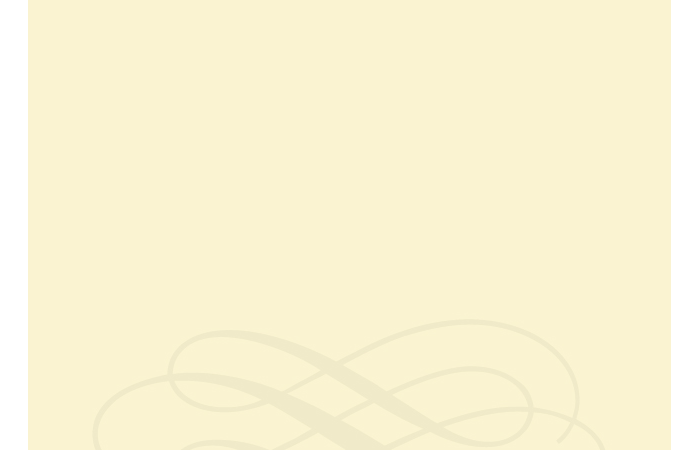
Textfunktion
Die pragmatische Analyse setzt die Formkritik fort, indem sie auf der Grundlage dessen, was in der Formkritik erarbeitet wurde, zunächst die Frage nach der Funktion des Textes stellt.
Die Funktionen von Texten sind direkt mit ihrer Form verbunden. Darstellende Texte wirken meist informativ und expressiv: Sie wollen dem Leser etwas vermitteln, das er hinterher wissen soll. Es geht ihnen also darum, einen Informationsgehalt bekannt zu machen.
Anders ist es bei den beratenden Texten. Diese sollen den Rezipienten zu einem Verhalten anleiten, das er so bisher noch nicht an den Tag legte. Dieses kann auf unterschiedlichen Ebenen geschehen: Der Leser kann eine direkte Handlungsanleitung bekommen oder ihm kann ein beispielhaftes Verhalten geschildert werden, das er sowohl nachahmen als auch auf andere Handlungsbereiche und -ebenen übertragen kann.
Die beurteilenden Texte wiederum dienen zur Unterstützung des Meinungsbildungsprozesses. In ihnen werden Zustände und / oder Geisteshaltungen positiv oder negativ bewertet. Es können auch Konsequenzen angesagt werden, die ein bestimmtes Verhalten haben wird. Dabei wirken sie Verhältnisse begründend, da vom Leser natürlich erwartet wird, dass er dem in ihnen enthaltene Urteil als solches akzeptiert und ihm Folge leistet.
Leserlenkung
Natürlich ist es nicht nur von Interesse, herauszufinden, welche Funktion ein Text hat, sondern auch, wie der Autor es anstellt, dass der Leser die intendiert Botschaft erhält. Damit stellt sich die Frage, wie der Autor den Leser lenkt. Dieses kann wiederum auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen, die ineinander greifen können (aber nicht müssen). Der Autor setzt, um mit seinem Text eine profilierte Aussage treffen zu können, einen Schwerpunkt (oder auch Schwerpunkte). Dieses kann er durch die Argumentationsstruktur oder durch Auslassungen erreichen. Zudem bietet er dem Leser eine Identifikationsfigur an, womit der Leser auch eine Stellung im Text erhält.
Diese beiden Analyseschritte werden im Nachfolgenden am Textbeispiel Mt 8,5-13 expliziert:
Der Text Mt 8,5-13 hat in seiner im heutigen Bibeltext vorliegenden Form eine dikanische, also beurteilende Form. Im Mittelpunkt des Textes steht die antithetische Aussage Jesu, derart wahren Glauben in Israel noch nicht vorgefunden zu haben, womit die kommende Erwählung der Völker und die Verwerfung der Kinder des Reiches begründet wird. An dieser Stelle ist der Höhepunkt der Erzählung zu suchen, womit zugleich auch die Funktion dieses Textes sichtbar wird: Er möchte begründen, warum ein bestimmter Zustand gegeben ist.
Dieses lässt einen ersten Rückschluss auf die matthäische Gemeinde zu: In ihr waren sowohl Christen jüdischen Ursprungs als auch Christen, die einem pagan-hellenistischen Umfeld entstammen, vereint. Das in dem dikanischen Spruch steckende Urteil deutet darauf hin, dass es innerhalb der Gemeinde Diskussion um die Stellung der beiden Gruppen zueinander gab. Mit der Betonung der Glaubens bei einem Vertreter der Völker wird der wohl bestehende Anspruch von jüdisch stämmigen Menschen auf eine Vorrangstellung im Gottesreich relativiert. Doch auch wenn der Spruch auf eine Scheidung hinausläuft, diese ist zeitaktuell zu erwarten und damit auch nicht durchzuführen, sondern sie wird erst in der Endzeit erfolgen. So lange wird die Möglichkeit bestehen, Glauben, wie ihn der Hauptmann lebte, an den Tag zu legen.
Die Aussageabsicht des Autors wird auch anhand der Leserlenkung deutlich: Zunächst versetzt er den Leser in eine für die Jesus-Bewegung alltägliche Situation. In ihr wird Jesus um eine Heilung ersucht, der er auch auf übliche Weise nachkommen will - er will in das Haus des Hauptmanns gehen. Die Ablehnung des Hauptmanns ist an dieser Stelle ungewöhnlich und durchbricht den gewohnten Verlauf.
Der anschließende Dialog erhält mit der Darstellung des beruflichen Umfelds des Hauptmanns eine Handlungsanweisung für den Leser: So, wie die Soldaten zum Hauptmann stehen, so soll er sich auch zu Jesus stellen. Die Anrede ,Herr‘, die der Hauptmann Jesus gegenüber verwendet, macht ihre gegenseitige Stellung deutlich. In dieser Position wähnt sich auch der Christ gegenüber seinem Herrn Jesus Christus.
Mit dem einsetzenden Monolog Jesu wird die Leserlenkung verschoben: In diesem Teil ist es nicht mehr der Hauptmann, denn dieser wird als Ausnahmefall hervorgehoben, mit dem sich der Leser auf eine Stufe stellt, sondern er wird Teil der angeredeten Menge. Das Verhalten des Hauptmanns wird als beispielhaft hervorgehoben, das auch dem Leser zum Vorbild dienen soll. Im anschließenden Urteilsspruch wird ihm vor Augen geführt, welche Konsequenzen eschatologisch zu erwarten sind. Das heißt für den Leser zugleich, dass er nicht damit rechnen darf, sofortige Auswirkungen auf sein Leben zu erwarten. Diese werden sich erst noch ergeben, wobei es an jedem einzelnen liegt, das Leben in die rechten Bahnen zu lenken.
Mit der Formkritik wurde bereits sichtbar, was der Autor mit seinem Text bezwecken möchte (Intention). Mit der pragmatischen Analyse wird nun danach gefragt, wie der Autor sein Ziel erreicht.