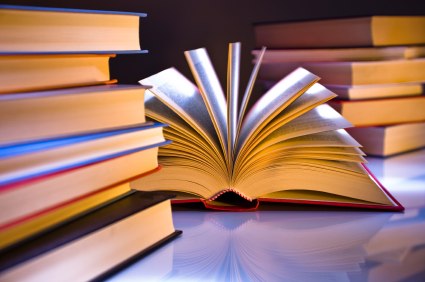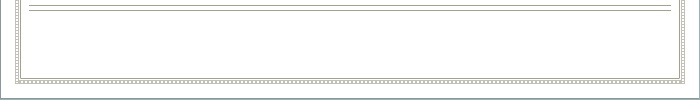Redaktionskritik


Redaktionskritik

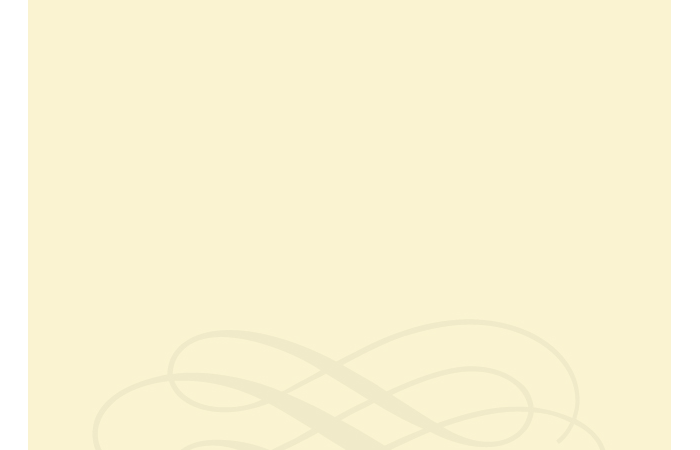
Theologische Leitlinien
Biblische Schriften wollen Menschen zum Glauben führen - auch wenn dies in den Texten nur an einigen Stellen direkt anklingt, so lässt sich bei näherem Hinsehen doch feststellen, dass die Schriften des Alten und des Neuen Testaments ihre Hörer und Leser von der Wahrheit ihrer Botschaft überzeugen wollen. Und dies machen sie auf unterschiedliche Weisen. Narrative Texte stehen ebenso wie bekennende, Lob preisende, klagende und argumentierende Texte innerhalb der biblischen Schriften. So unterschiedlich die Form und damit auch der Sitz im Leben dieser Texte ist, sie haben allesamt das Bestreben, die Geschichte Gottes mit dem Menschen sowohl als faktische als auch als exemplarische Geschichte zu erzählen.
In der Formkritik und der pragmatischen Analyse wurde bereits die besondere Stoßrichtung des zu untersuchenden Einzeltextes bedacht. Diese Einsichten gilt es nun in der Redaktionskritik wieder aufzunehmen und mit der Frage zu verbinden, in welchen anderen Textabschnitten (Perikopen) des biblischen Buches, aus dem der zu behandelnde Text stammt, vergleichbare Aussagen getroffen werden. Auf diese Weise ist es möglich, eine theologische Leitlinie des Autors zu zeigen. Entscheidend ist dabei, dass die vom Autor gebotenen Nuancen deutlich sichtbar werden. Es geht also nicht darum, einen Abriss der gesamten Theologie des biblischen Buches zu bieten, sondern zu zeigen, welches theologische Thema im untersuchten Text behandelt wird, an welchen weiteren Stellen sich der Autor dazu äußert und welches Gesamtbild bezogen auf dieses einzelne Thema sich daraus ergibt.
Zum Beispieltext
In der Form- und Gattungskritik wurde bereits deutlich, dass Mt 8,5-13 in der Katechese eingesetzt wird und das Thema ,Ausbildung der christlichen Gemeinschaft‘ behandelt. Dabei zeigt der Text zwei Besonderheiten: 1. Das Christentum ist ein corpus permixtum, der sich aus Juden und Heiden zusammensetzt. Das entscheidende Kriterium für die Zugehörigkeit zur erlösten Gemeinschaft ist der Glaube, wie der Hauptmann ihn exemplarisch zeigt. 2. Eine Trennung der Gemeinde in Berufene und Verstoßene wird sich erst eschatologisch ergeben. Bis zum Tag des Gerichts werden Menschen beider Ausprägung zur Gemeinde gehören, ohne dass ihr Status bereits bestimmt ist.
Diese beiden Gedanken finden sich innerhalb des Matthäusevangeliums an verschiedenen Stellen. Die Ausrichtung auf die Integration von Menschen nicht-jüdischer Herkunft in die christliche Gemeinde wird durch den Missionsbefehl in Mt 28,18-20 deutlich. Die Gemeinde erhält den Auftrag, aktiv Menschen zu missionieren und durch die Taufe in die bestehende Gemeinschaft aufzunehmen. Dabei versteht sich die Gemeinde insofern als jüdisch, als dass die für das Judentum verbindlichen Regeln auch für die christliche Gemeinde gelten (vgl. Mt 5,17). Die Bergpredigt gibt mit den Seligpreisungen und den Antithesen das richtige Verhalten der Gemeinde voraus: Die Gemeindeglieder sollen selig sein und sie sollen den verschärften Regeln, die in den Antithesen formuliert werden, folgen. Erst damit werden die Christen dem göttlichen Willen entsprechen. Der Glaube, den der Hauptmann äußert, entspricht diesen Vorstellungen insofern strukturell, als dass er ein Zutrauen zu Jesus äußert, das über das bisher gewöhnliche Maß hinausgeht.
Die eschatologische Scheidung von Berufenen und Verworfenen wird im Sinne von Mt 8,11f. vor allem in den Gerichtsgleichnissen in Mt 25 expliziert. Die drei Gleichnisse zeigen deutlich an, dass die Gemeinde bis zum eschatologischen Gerichtstag als gemischte Gemeinschaft existieren wird und dass das Gericht in der Scheidung der Gemeinde vonstatten gehen wird. Dabei betont der Autor sowohl in Mt 8,5-13 als auch in Mt 25,14-30 die Eigenverantwortung des einzelnen Christen: Es liegt an ihm, ob er am Gerichtstag in das Gottesreich einziehen wird. Er hat mit der Botschaft vom Tod und der Auferstehung Jesu den entscheidenden Fingerzeig bekommen. Wie sie im Leben umgesetzt wird, obliegt jedem einzelnen. Das Gleichnis vom anvertrauten Zentner zeigt, dass rechter Umgang mit der Botschaft auf keinen Fall das stillschweigende Bewahren ist. Vielmehr geht es im Sinne des Missionsbefehl darum, die Botschaft weiterzutragen. Eine besondere Schwierigkeit für die Gemeinde stellt der Umgang mit Menschen dar, die vom rechten Lebensweg abweichen. Die Gemeinderegel in Mt 18 geht auf diese Frage im besonderen ein und zeigt, dass es eben jedem Menschen bis zum Gerichtstag offen steht, wieder auf den rechten Weg zu gelangen. Dabei warnt der Autor mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Mt 25,1-13 jedoch davor, dass der Zeitpunkt des Gerichts unbestimmt ist. Daher darf man, wenn man einmal verstanden hat, dass man sich auf Abwegen befindet, nicht lange zögern, diese wieder zu verlassen und zu versuchen, nach den im Evangelium gegebenen Regeln und im Glauben, wie ihn der Hauptmann zeigt, zu leben.
Die einzelnen biblischen Texte (Perikopen) sind Teil eines größeren Werkes, aus dem sie entnommen sind. Damit sind sie Bestandteil eines Argumentationsganges, mit dem der Verfasser seine Hörer und Leser von der Richtigkeit seiner Botschaft überzeugen will. Aussagen, die in den einzelnen Perikopen getroffen werden, stehen also in einem weiteren Kontext. Sie sind ein Baustein der Theologie des Autors. Aufgabe der Redaktionsgeschichte ist es daher, die theologischen Leitlinien aufzuzeigen, die sich im behandelten Text zeigen und die im Gesamtwerk von Bedeutung sind.